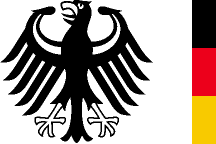Die Prinzipien im Regelungstext
Hier finden Sie Regelungsbeispiele zur Anwendung der Prinzipien.
Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen
Alle Menschen haben ein Recht darauf, dass ihre Daten vor unbefugten Zugriffen geschützt werden. Der Schutz personenbezogener Daten ist in der DSGVO (öffnet in neuem Fenster) geregelt. Informationssicherheit umfasst alle Daten und wird je nach Bereich spezifiziert.
Eine datenschutzkonforme Regelung erhebt nur das Minimum an Daten. Datensparsamkeit ist einfach umzusetzen und verringert den Erfüllungsaufwand. Wenn weniger Daten vorliegen, müssen auch weniger Informationen geschützt werden.
Wenn Informationen den ihnen gebührenden Schutz erhalten, schafft das Vertrauen in den Staat. Die Gefahr von Missbrauch und negativen wirtschaftlichen oder sicherheitsrelevanten Konsequenzen wird verringert.
Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten – LuftVG
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 66a LuftVG Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten
(1)
(1) Das Luftfahrt-Bundesamt führt ein Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten, die im Fall von natürlichen Personen ihren Hauptwohnsitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland oder im Fall von juristischen Personen ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland haben und die eines der folgenden unbemannten Fluggeräte betreiben:
- ein unbemanntes Fluggerät in der Betriebskategorie „offen“ mit einer Startmasse von 250 Gramm oder mehr, das bei einem Aufprall auf einen Menschen eine kinetische Energie von über 80 Joule übertragen kann,
- ein unbemanntes Fluggerät in der Betriebskategorie „offen“, das mit einem Sensor, der personenbezogene Daten erheben und speichern kann, ausgerüstet ist, sofern es nicht der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug (ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1020 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung genügt, oder
- ein unbemanntes Fluggerät einer beliebigen Masse in der Betriebskategorie „speziell“.
Das Register nach Satz 1 dient dazu, die Erfüllung von Aufgaben des Luftfahrt-Bundesamtes hinsichtlich der Registrierung von Betreibern und zum Austausch von Informationen nach Artikel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 sicherzustellen.
(2) Das Luftfahrt-Bundesamt ist befugt, in dem Register nach Absatz 1 zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zweck folgende Daten zu erheben, zu speichern und zu verwenden:
- vollständiger Name und Geburtsdatum des Betreibers bei natürlichen Personen und Name oder Firma und Registergericht und Registernummer bei juristischen Personen,
- Anschrift des Betreibers,
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Betreibers,
- Nummer der Versicherungspolice für das unbemannte Fluggerät des Betreibers,
- Bestätigung folgender Erklärung durch juristische Personen: „Das unmittelbar am Betrieb beteiligte Personal verfügt über die zur Durchführung seiner Aufgaben notwendigen Kompetenzen und das unbemannte Fluggerät wird nur von Fernpiloten mit angemessenem Kompetenzniveau betrieben“ und
- vorhandene Betriebsgenehmigungen und das einem Betreiber von der zuständigen Behörde nach Teil C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ausgestellte Betreiberzeugnis sowie Erklärungen mit einer Bestätigung nach Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe b der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Legt für die datenschutzkonforme Umsetzung detailliert fest, welche Daten des Betreibers erhoben, gespeichert und verwendet werden dürfen.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(3)
(3) Betreiber von unbemannten Fluggeräten nach Absatz 1 Satz 1 haben dem Luftfahrt-Bundesamt vor der erstmaligen Aufnahme des Betriebs die für die Registrierung zu speichernden Daten nach Absatz 2 zu übermitteln und deren Richtigkeit auf Verlangen zu belegen, soweit dies für die Registrierung durch das Luftfahrt-Bundesamt erforderlich ist. Registrierte Betreiber haben dem Luftfahrt-Bundesamt unverzüglich jede Änderung der Voraussetzungen für eine Registrierung nach Absatz 1 und jede Änderung der Daten nach Absatz 2 zu übermitteln. Das Luftfahrt-Bundesamt kann Verwaltungsakte hinsichtlich der Registrierung eines Betreibers sowie Gebührenbescheide für die Registrierung durch automatische Einrichtungen erlassen. Betreiber haben das Recht auf Darlegung des eigenen Standpunktes und das Recht auf Entscheidung durch einen Amtsträger. Satz 3 gilt nicht, wenn ein Betreiber Rechte nach Satz 4 geltend macht oder wenn aus anderen Gründen Anlass besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. Setzt das Luftfahrt-Bundesamt automatische Einrichtungen zum Erlass von Verwaltungsakten ein, muss es Angaben des Betreibers berücksichtigen, die für den Einzelfall bedeutsam sind und im automatischen Verfahren nicht ermittelt würden.
(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 können Luftsportverbände die für die Registrierung zu speichernden Daten ihrer Mitglieder, die unbemannte Fluggeräte nach Absatz 1 Satz 1 betreiben, dem Luftfahrt-Bundesamt unter Beachtung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) übermitteln. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Verweist auf die DSGVO.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(5) – (8)
(5) Das Luftfahrt-Bundesamt übermittelt jedem Betreiber nach Absatz 1 Satz 1 elektronisch eine Registrierungsnummer, die für alle von ihm nach Absatz 1 Satz 1 betriebenen unbemannten Fluggeräte gilt und dem Luftfahrt-Bundesamt eine individuelle Identifizierung des Betreibers nach Artikel 14 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 ermöglicht. Das Luftfahrt-Bundesamt kann die Registrierung eines Betreibers eines unbemannten Fluggerätes für den Betrieb in den Betriebskategorien „offen“ und „speziell“ durch automatische Einrichtungen bestätigen, sofern kein Anlass besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten; Absatz 3 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. Das Luftfahrt-Bundesamt stellt sicher, dass das Register insbesondere den Vorgaben der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 entspricht.
(6) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten dürfen vom Luftfahrt-Bundesamt an die für die in den Nummern 1 bis 4 genannten Aufgaben zuständigen Stellen des Bundes und der Länder sowie anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermittelt werden, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist
- für Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Luftverkehrs,
- zur Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Luftverkehrsvorschriften,
- zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, wobei die Regelungen des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen unberührt bleiben, oder
- zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.
Die nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 gespeicherten Daten dürfen vom Luftfahrt-Bundesamt an die Verfassungsschutzbehörden übermittelt werden, soweit dies im Einzelfall zur Erfüllung der den Verfassungsschutzbehörden durch Gesetz übertragenen Aufgaben unerlässlich ist und die nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 gespeicherten Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu erlangen sind. Die für die Aufgaben in den nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 zuständigen Stellen und die nach Satz 2 zuständigen Behörden haben Aufzeichnungen über das Ersuchen mit einem Hinweis auf dessen Anlass zu führen. Die Aufzeichnungen sind gesondert aufzubewahren, durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Erstellung der Aufzeichnung folgt, zu vernichten. Die Aufzeichnungen dürfen nur zur Kontrolle der Zulässigkeit der Übermittlungen verwertet werden, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ihre Verwertung zur Aufklärung oder Verhütung einer schwerwiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder Freiheit einer Person führen kann und die Aufklärung oder Verhütung ohne diese Maßnahme aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der Empfänger der Auskunft ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die in Absatz 2 genannten Daten nur zu dem Zweck verwendet werden dürfen, zu dem sie übermittelt werden.
(7) Die Übermittlung nach Absatz 6 Satz 1 aus dem Register darf durch Abruf im automatisierten Verfahren an die Polizeien des Bundes und der Länder erfolgen
- zur Verfolgung von Straftaten oder
- zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit,
wenn diese Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu erlangen sind. Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen automatisierten Abrufs trägt die abrufende Stelle. Das Luftfahrt-Bundesamt überprüft die Zulässigkeit des Abrufs nur, wenn dazu Anlass besteht.
(8) Die Übermittlung nach Absatz 6 Satz 2 aus dem Register darf durch Abruf im automatisierten Verfahren an die Verfassungsschutzbehörden zur Erfüllung der ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben erfolgen, wenn diese Daten auf andere Weise nicht oder nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu erlangen sind. Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(9) Die nach Absatz 2 gespeicherten Daten sind vom Luftfahrt-Bundesamt unverzüglich zu löschen, soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 nicht mehr erforderlich sind, spätestens nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Tag ihrer Speicherung. Wird dem Luftfahrt-Bundesamt innerhalb dieser Frist die Einleitung von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze bei der Tätigkeit als Betreiber nach Absatz 1 bekannt und sind die Daten nach Absatz 2 im Einzelfall für die Durchführung dieser Ermittlungen und eines sich hieran anschließenden Strafverfahrens erforderlich, sind die nach Absatz 2 gespeicherten Daten abweichend von Satz 1 vom Luftfahrt-Bundesamt mit dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens oder dem rechtskräftigen Abschluss des sich hieran anschließenden Strafverfahrens unverzüglich zu löschen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Klare Löschfristen und -bedingungen für die Daten werden definiert.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(10) Das Luftfahrt-Bundesamt legt im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik insbesondere unter Beachtung der Vorgaben der Artikel 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 nähere Anforderungen an das Datenformat sowie die Anforderungen an die Sicherheit gegen unbefugte Zugriffe auf das Register und bei der Datenübertragung fest. Sie haben dem Stand der Technik zu entsprechen und sind vom Luftfahrt-Bundesamt im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik fortlaufend anzupassen
Warum ist dieses Beispiel gut?
- Bezieht Experten (BSI) in die Erarbeitung der Sicherheitsanforderungen mit ein.
- Diese sollen fortlaufend auf dem neuesten Stand gehalten werden.
- Verweist auf die relevanten Stellen der DSGVO.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(11) Das Luftfahrt-Bundesamt hat über die Abrufe Aufzeichnungen zu fertigen, die die bei der Durchführung der Abrufe verwendeten Daten, den Tag und die Uhrzeit der Abrufe, die Kennung der abrufenden Dienststelle und die abgerufenen Daten enthalten müssen. Ferner sind bei Abrufen aus dem Register über Betreiber von unbemannten Fluggeräten vom Luftfahrt-Bundesamt weitere Aufzeichnungen zu fertigen, die sich auf den Anlass des Abrufs erstrecken und die Feststellung der für den Abruf verantwortlichen Personen ermöglichen. Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die Protokolldaten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schützen und nach sechs Monaten zu löschen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Schreibt die Erstellung, Sicherung und Löschfristen von Protokollen vor, um eine spätere Überprüfung von u. A. Datenschutz und Datensicherung zu ermöglichen.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(12)
(12) Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben sind als Betreiber unbemannter Fluggeräte von der Registrierungspflicht ausgenommen.
- Fassung vom
- 25. Juli 2024
- Ressort
- BMV
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit – BIPAM-ErrichtungsG
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 2 BIPAM–ErrichtungsG Aufgaben des Bundesinstituts
(1)
(1) Das Bundesinstitut nimmt Aufgaben des Bundes auf den Gebieten der Öffentlichen Gesundheit wahr, die ihm durch dieses Gesetz oder durch andere Bundesgesetze oder auf Grund dieser Gesetze zugewiesen werden. Die Aufgaben bestehender Einrichtungen des Bundes außerhalb des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums für Gesundheit bleiben davon unberührt. Das Bundesinstitut übernimmt die Aufgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, einschließlich derer aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
(2) Das Bundesinstitut nimmt Aufgaben nach Absatz 1, einschließlich der damit verbundenen Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten im Umfang der jeweils einschlägigen fachrechtlichen Bestimmungen, insbesondere auf folgenden Gebieten wahr:
- Beobachtung von gesundheitsrelevanten Faktoren und von gesundheitlichen Rahmenbedingungen
- Gesundheitsberichterstattung des Bundes, einschließlich Gesundheitsmonitoring
- Stärkung der Öffentlichen Gesundheit durch freiwillige Kooperation und Vernetzung mit Akteuren der Öffentlichen Gesundheit,
- evidenzbasierte, zielgruppenspezifische, insbesondere auf vulnerable Bevölkerungsgruppen ausgerichtete Kommunikation im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit,
- Stärkung der Vorbeugung und Verhütung von Krankheiten sowie Stärkung der Gesundheitsförderung und der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung, jeweils im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes,
- wissenschaftliche Forschung und Zusammenarbeit mit Institutionen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene, einschließlich der Unterstützung dieser Institutionen bei der Entwicklung von Leitlinien und Standards.
Besondere Vorschriften zur Bestimmung von Aufgaben bleiben hiervon unberührt, insbesondere die Aufgaben des Robert Koch-Instituts nach § 4 des Infektionsschutzgesetzes und nach § 2 Absatz 3 in Verbindung mit § 4 des BGA-Nachfolgegesetzes.
Warum ist dieses Beispiel gut?
- Nennt explizit die Verarbeitung personenbezogener Daten als Spezifizierung der Aufgaben von Absatz 1.
- Konkretisiert die Art der personenbezogenen Daten (Gesundheitsdaten) und verweist darüber hinaus auf die dafür geltenden fachrechtlichen Bestimmungen.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(3)
(3) Das Bundesinstitut erledigt, soweit keine andere Zuständigkeit gesetzlich festgelegt ist, in seinem Zuständigkeitsbereich weitere Aufgaben des Bundes, die mit den in den Absätzen 1 und 2 genannten Gebieten zusammenhängen und mit deren Durchführung es vom Bundesministerium für Gesundheit oder mit dessen Zustimmung von der sachlich zuständigen obersten Bundesbehörde beauftragt wird.
- Fassung vom
- 17. Juli 2024
- Ressort
- BMG
Elektronischer Rechtsverkehr mit dem Bundesverfassungsgericht – BVerfGG
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 23a BVerfGG
(1) – (2)
(1) Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen sowie sonstige Schriftsätze und deren Anlagen können nach Maßgabe der folgenden Absätze als elektronische Dokumente beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden.
(2) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Bundesverfassungsgericht geeignet sein. Für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Bundesverfassungsgericht gelten die in der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung geregelten technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs entsprechend.
(3) Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. Satz 1 gilt nicht für Anlagen. Soll ein schriftlich einzureichender Antrag oder eine schriftlich einzureichende Erklärung eines Beteiligten oder eines Dritten als elektronisches Dokument eingereicht werden, so kann der unterschriebene Antrag oder die unterschriebene Erklärung in ein elektronisches Dokument übertragen und durch den Bevollmächtigten, den Vertreter oder den Beistand nach Satz 1 übermittelt werden.
Warum ist dieses Beispiel gut?
- Steigert den Schutz vor Fälschungen durch Verwendung eines geeigneten kryptografischen Verfahrens (qualifizierte elektronische Signatur).
- Führt zu erhöhter Informationssicherheit durch die Nutzung eines sicheren Übermittlungsweges (siehe Absatz 3). Dies schützt die Daten vor Veränderung und unerlaubter Einsicht während der Übertragung.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(4) – (6)
(4) Sichere Übermittlungswege sind
- der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist und er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes bestätigen lässt,
- der Übermittlungsweg zwischen den besonderen elektronischen Anwaltspostfächern nach den §§ 31a und 31b der Bundesrechtsanwaltsordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen Poststelle des Bundesverfassungsgerichts,
- der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten Postfach einer Behörde oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts und der elektronischen Poststelle des Bundesverfassungsgerichts,
- der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens eingerichteten elektronischen Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder einer sonstigen Vereinigung und der elektronischen Poststelle des Bundesverfassungsgerichts,
- der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens genutzten Postfach- und Versanddienst eines Nutzerkontos im Sinne des § 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes und der elektronischen Poststelle des Bundesverfassungsgerichts,
- sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, bei denen die Authentizität und Integrität der Daten sowie die Barrierefreiheit gewährleistet sind.
Für die Übermittlungswege gemäß Satz 1 Nummer 3 bis 5 gelten die näheren Regelungen der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung entsprechend.
(5) Ein elektronisches Dokument ist eingegangen, sobald es auf der für den Empfang bestimmten Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts gespeichert ist. Dem Absender ist eine automatisierte Bestätigung über den Zeitpunkt des Eingangs zu erteilen.
(6) Ist ein elektronisches Dokument für das Bundesverfassungsgericht zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender unter Hinweis auf die Unwirksamkeit des Eingangs unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument gilt als zum Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, sofern der Absender es unverzüglich in einer für das Bundesverfassungsgericht zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich übereinstimmt.
- Fassung vom
- 01. August 2024
- Ressort
- BMJV
Identifikation der Nutzer Unternehmensregisterverordnung – URV
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 3a URV Identifikation der Nutzer
(1)
(1) Für eine Registrierung nach § 3 Absatz 2 hat eine elektronische Identifikation des Nutzers zu erfolgen. Nutzer ist diejenige natürliche Person, die eine Datenübermittlung nach § 11 Absatz 2 für Veröffentlichungs- und Offenlegungspflichtige tatsächlich vornehmen soll. Die elektronische Identifikation erfolgt anhand
- eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach § 12 des eID-Karte- Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes,
- eines elektronischen Identifizierungsmittels, das von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellt wurde und das
- für die Zwecke der grenzüberschreitenden Authentifizierung nach Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73; L 23 vom 29.1.2015, S. 19; L 155 vom 14.6.2016, S. 44), die durch die Richtlinie (EU) 2022/2555 (ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 80) geändert worden ist, anerkannt wird und
- dem Sicherheitsniveau „hoch“ im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht, oder
- einer von der registerführenden Stelle zur Verfügung gestellten Identifizierungsmethode im Sinne des Artikels 24 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014.
(2) Bei erfolgreicher Identifikation werden der Prozessnachweis, der Familienname und die Vornamen des Nutzers im Nutzerkonto gespeichert. Die folgenden Identifizierungsdaten werden im Unternehmensregister gespeichert und sind acht Jahre nach der letzten Datenübermittlung zu löschen:
- Titel,
- Tag der Geburt,
- Anschrift,
- Dokumentenart des Ausweisdokuments,
- Zeitstempel.
Sofern keine Datenübermittlung erfolgt ist, sind die in Satz 2 genannten Daten acht Jahre nach Abschluss des Identifikationsvorganges zu löschen. Weitere im Rahmen der Identifizierung erhobene Daten sind drei Monate nach Abschluss des Identifikationsvorganges zu löschen. Bei erfolgloser Identifikation werden der Prozessnachweis, der Familienname und die Vornamen des Nutzers zusammen mit den Daten nach Satz 3 gelöscht.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Spezifiziert einen vergleichsweise geringen Umfang an Daten und verknüpft diese bereits mit einer Löschfrist.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(3) – (4)
(3) Hat die registerführende Stelle im Rahmen der Registrierung oder der Datenübermittlung nach § 11 Absatz 2 Satz 1 ernstliche Zweifel an der Rechtsfähigkeit oder Geschäftsfähigkeit eines Nutzers oder an seiner Berechtigung zur Datenübermittlung, so kann die registerführende Stelle von ihm oder dem für ihn handelnden Berechtigten die Übermittlung geeigneter Nachweise oder eine erneute Identifikation verlangen.
(4) Die registerführende Stelle ist befugt, nach ihren technischen Vorgaben eine Schnittstelle zur Steuerberaterplattform nach § 86c des Steuerberatungsgesetzes einzurichten. Ist eine solche Schnittstelle eingerichtet, so müssen sich Nutzer, die bereits über die Steuerberaterplattform identifiziert sind, für die Registrierung nach § 3 nicht nach Absatz 1 identifizieren. In diesen Fällen kann die registerführende Stelle vom Betreiber der Steuerberaterplattform verlangen, ihr die dort erhobenen Identifizierungsdaten über die Schnittstelle zu übermitteln. Die registerführende Stelle ist befugt, die übermittelten Identifizierungsdaten und die Daten der SAFE-Visitenkarte zu verarbeiten. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die registerführende Stelle ist berechtigt, sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der ihr übermittelten Daten zu verlassen, es sei denn, an deren Richtigkeit oder Vollständigkeit bestehen ernstliche Zweifel; in diesem Fall ist sie verpflichtet, vom Betreiber der Steuerberaterplattform die erforderlichen Nachweise über eine erfolgte Identifizierung zu verlangen.
- Fassung vom
- 08. Oktober 2024
- Ressort
- BMJV
Einrichtung Herkunftsnachweisregister für Gas, Wärme und Kälte - GWKHV
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 39 GWKH Überprüfung der gespeicherten Daten; Datenübermittlung
(1) – (2)
(1) Für einen effizienten Registerbetrieb gleicht das Umweltbundesamt die im Herkunftsnachweisregister für Gas und die im Herkunftsnachweisregister für Wärme oder Kälte gespeicherten Daten, einschließlich personenbezogener Daten, miteinander ab und tauscht sie zwischen diesen Registern aus im Hinblick auf die Erzeugung von
- Gas aus oder auf Basis von thermischer Energie sowie
- thermischer Energie aus Gas aus oder auf Basis von erneuerbarer Energie oder kohlenstoffarmem Gas.
(2) Das Umweltbundesamt kann die in den Herkunftsnachweisregistern nach § 3 eingetragenen Daten, einschließlich personenbezogener Daten, mit den Daten abgleichen, die
- im Herkunftsnachweisregister nach § 79 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gespeichert sind,
- im Marktstammdatenregister nach § 111e Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 32) geändert worden ist, gespeichert sind,
- im Register Biostrom nach § 44 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung gespeichert sind,
- im Register Biokraftstoffe nach § 42 der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung gespeichert sind,
- der zuständigen Stelle nach § 37d Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist, vorliegen,
- in der Datenbank Nachhaltige-Biomasse-Systeme gespeichert sind,
- im Biogasregister der Deutschen Energie-Agentur gespeichert sind oder
- das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Rahmen der Durchführung seiner Aufgaben nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder nach der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze „BEW“ vom 1. August 2022 (Banz AT 18.08.2022 B1) erhoben und gespeichert hat.
Das Umweltbundesamt kann Daten nach den Sätzen 3 und 4 mit dem Betreiber eines Registers oder einer Datenbank austauschen, soweit dies zur Gewährleistung der Sicherheit, der Richtigkeit oder der Zuverlässigkeit der Herkunftsnachweisregister nach § 3 erforderlich ist. Zu diesem Zwecke darf das Umweltbundesamt Daten aus einem Register oder einer Datenbank nach Satz 1 erheben, speichern und verwenden, soweit diesbezüglich eine Mitteilungspflicht eines Registerteilnehmers nach dieser Verordnung besteht. Das Umweltbundesamt darf Daten an den Betreiber eines Registers oder einer Datenbank nach Satz 1 übermitteln, soweit die Daten dem Umweltbundesamt und in dem Register oder der Datenbank nach Satz 1 vorliegen und diesbezüglich eine Mitteilungspflicht des Registerteilnehmers im Zusammenhang mit dem Betrieb des jeweiligen Registers oder der jeweiligen Datenbank nach Satz 1 besteht.
(3) Soweit es zur Durchführung dieser Verordnung erforderlich ist, darf das Umweltbundesamt Daten aus dem Herkunftsnachweisregister für Gas oder dem Herkunftsnachweisregister für Wärme oder Kälte übermitteln an
- das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz,
- das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz,
- das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,
- die nachgeordneten Behörden der in den Nummern 1 bis 3 genannten Bundesministerien,
- Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und von Drittstaaten sowie
- Organe der Europäischen Union.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Schränkt die Datenübermittlung durch die Zweckbindung ein.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(4) Das Umweltbundesamt kann den Betreibern der Datenbanken und der Register nach Absatz 2 sowie den Behörden nach Absatz 3 über elektronische Schnittstellen den Zugang zu den in einem Herkunftsnachweisregister nach § 3 gespeicherten Daten, einschließlich personenbezogener Daten, ermöglichen. Das Umweltbundesamt als übermittelnde Stelle hat über die Abrufe nach Satz 1 Aufzeichnungen zu fertigen, die die folgenden Daten enthalten müssen:
- die bei der Durchführung der Abrufe verwendeten Daten,
- den Tag und die Uhrzeit der Abrufe,
- die Kennung der abrufenden Dienststelle und
- die abgerufenen Daten.
Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle oder Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Die protokollierten Daten sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweckfremde Verwendung und gegen sonstigen Missbrauch zu schützen. Die protokollierten Daten sind sechs Monate nach der Protokollierung zu löschen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
- Erfordert Sicherheitsvorkehrungen, die allerdings noch näher spezifiziert werden müssten.
- Legt klare Löschfristen fest.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(5)
(5) Das Umweltbundesamt richtet eine elektronische Schnittstelle ein, die es ermöglicht, Daten an die nach Landesrecht zuständigen Behörden zu übermitteln, soweit es für den Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist, erforderlich ist. Absatz 4 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
- Fassung vom
- 24. Januar 2024
- Ressort
- BMWE
Modernisierung des Postrechts – PostG
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 67 PostG Datenschutz
(1) Für Diensteanbieter werden die Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung durch die Regelungen des § 65 sowie der §§ 68 bis 71 ergänzt.
Warum ist dieses Beispiel gut?
- DSGVO ist zentrale Grundlage für Datenschutz.
- §§ 65, 68-71 Postmodernisierungsgesetz ergänzen die Vorgaben für den Postbereich. Damit wird rechtssichere und datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten im Postsektor gewährleistet.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
§ 69 PostG Ausweisdaten
(1) – (3)
(1) Diensteanbieter können von am Postverkehr Beteiligten verlangen, sich über ihre Person durch Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Passes oder durch Vorlage sonstiger amtlicher Ausweispapiere auszuweisen, um die ordnungsgemäße Ausführung des Postdienstes sicherzustellen.
(2) Besteht ein besonderes Beweissicherungsinteresse, so können zum späteren Beweis der ordnungsgemäßen Ausführung des Postdienstes folgende Daten des Ausweispapiers gespeichert werden:
- die Art des Ausweises,
- die ausstellende Behörde,
- die Nummer des Ausweises sowie
- das Ausstellungsdatum.
(3) Eine Verarbeitung der Daten ist zulässig, um einen Beweis über die ordnungsgemäße Ausführung des Postdienstes zu erbringen.
(4) Die Daten sind spätestens sechs Monate nach Ablauf gesetzlicher oder vertraglicher Verjährungsfristen zu löschen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Sensible, nicht mehr benötigte Daten werden gelöscht, sodass sie nicht mehr verfügbar sind – das schützt sie vor Missbrauch.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
§ 92 PostG Verfahren zur Übermittlung von Informationen
(1) Soweit dieses Gesetz natürliche oder juristische Personen dazu verpflichtet, Informationen an die Bundesnetzagentur zu übermitteln, soll die Übermittlung ausschließlich elektronisch erfolgen, es sei denn, das Gesetz sieht ausdrücklich eine andere Form der Übermittlung vor. Zu diesem Zweck stellt die Bundesnetzagentur entsprechende elektronische Verfahren zur Verfügung, die eine sichere Übermittlung und Nutzung der Informationen sicherstellt. Die Bundesnetzagentur gewährleistet insbesondere den Schutz personenbezogener Daten und den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Die Bundesnetzagentur wird ausdrücklich als besonders verantwortlich für Datenschutz und Informationssicherheit benannt.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(2) – (3)
(2) Soweit Informationen regelmäßig zu übermitteln sind, soll die Bundesnetzagentur verschiedene Informationen nach Möglichkeit gebündelt abfragen, um den Aufwand der Betroffenen gering zu halten.
(3) Soweit die Bundesnetzagentur auf Grundlage dieses Gesetzes mit natürlichen oder juristischen Personen in Kontakt tritt, soll dies ausschließlich elektronisch, soweit möglich unter Nutzung der nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e und Nummer 2 Buchstabe e, jeweils auch in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Nummer 2 gemeldeten Adresse für die elektronische Kommunikation, erfolgen, es sei denn, das Gesetz sieht ausdrücklich eine andere Form vor.
§ 93 PostG Datennutzung
(1)
(1) Unbeschadet spezialgesetzlicher Regelungen ist die Bundesnetzagentur berechtigt, ihr vorliegende, aufgrund einer speziellen Ermächtigungsgrundlage erhobene Daten auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Aufgaben auszuwerten und zu nutzen. Dem steht die in § 90 Absatz 2 Satz 2 und 3 genannte Zweckbestimmung nicht entgegen.
(2) Die Bundesnetzagentur kann die ihr vorliegenden, den Postsektor betreffenden Daten, insbesondere die aufgrund eines Auskunftsverlangens nach § 90 erhaltenen Daten, für Dritte oder die Öffentlichkeit bereitstellen, soweit die Daten für die Öffentlichkeit Bedeutung haben können. Satz 1 gilt nicht für Daten, für die kein oder nur ein eingeschränktes Zugangsrecht insbesondere gemäß § 3 des Informationsfreiheitsgesetzes besteht, sowie für personenbezogene Daten und als solche gekennzeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Hinweis auf die Beschränkung von Zugangsrechten von personenbezogenen Daten, als auch Daten die § 3 Informationsfreiheitsgesetz unterliegen oder gekennzeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(3) Soweit erforderlich, werden diese Daten aggregiert oder unternehmensbezogene Angaben auf sonstige Weise unkenntlich gemacht. Die öffentliche Bereitstellung kann insbesondere auf der Internetseite der Bundesnetzagentur erfolgen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Daten können unkenntlich gemacht werden oder werden aggregiert, um geschützt zu werden.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
- Ressort
- BMWE
Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 1125 ZPO Digitale Eingabesysteme im Online-Verfahren; Verordnungsermächtigung
(1) – (2)
(1) Die digitalen Eingabesysteme nach § 1124 Absatz 1 und 2 werden vom Bundesministerium der Justiz als Referenzimplementierung entwickelt und den Ländern zur Anwendung bei den nach § 1123 bestimmten Gerichten bundeseinheitlich bereitgestellt. Die Länder können weitere digitale Eingabesysteme entwickeln und zur Anwendung bei den nach § 1123 bestimmten Gerichten bundeseinheitlich bereitstellen. Das Bundesministerium der Justiz regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die technischen, organisatorischen und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für Entwicklung, Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der digitalen Eingabesysteme nach Satz 2.
(2) Die nach Absatz 1 entwickelten digitalen Eingabesysteme sind über ein Justizportal des Bundes und der Länder für die Nutzer bereitzustellen. Sie sind nach Maßgabe der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung barrierefrei zu gestalten. Ferner ist bei der Gestaltung der digitalen Eingabesysteme deren Nutzerfreundlichkeit sowie eine einfache und intuitive Bedienbarkeit sicherzustellen.
(3) Die Stelle, die digitale Eingabesysteme nach Absatz 1 bereitstellt, darf personenbezogene Daten nur verarbeiten, soweit dies für die Zwecke der Unterstützung der digitalen Kommunikation nach § 1124 Absatz 1 und 2 erforderlich ist. Die Daten dürfen in den digitalen Eingabesystemen zwischengespeichert werden, um dem Nutzer zu ermöglichen, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu vervollständigen, zu korrigieren oder zu löschen. Die zwischengespeicherten Daten sind spätestens 30 Tage nach der letzten Bearbeitung der digitalen Eingabesysteme automatisch zu löschen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
- Legt die Zwecke fest, wann personenbezogene Daten verarbeitet werden können.
- Schreibt die Löschung personenbezogener Daten vor, was die Privatsphäre der Nutzer schützt und die Speicherung von Daten minimiert.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(4)
(4) Elektronische Dokumente, die mithilfe digitaler Eingabesysteme erzeugt wurden, können abweichend von § 2 Absatz 1 der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung als strukturierter Datensatz übermittelt werden, sofern für diesen im Online-Verfahren eine automatisierte Bearbeitung durch das Gericht eröffnet ist.
§ 1130 ZPO Entwicklung und Bereitstellung; Verordnungsermächtigungen
(1) – (3)
(1) Im Online-Verfahren kann eine Kommunikationsplattform genutzt werden, die der bundeseinheitlichen Erprobung digitaler Kommunikations-, Austausch- und Übermittlungsformen zwischen den Verfahrensbeteiligten und mit dem Gericht dient. Die Kommunikationsplattform kann auch zur Bereitstellung oder gemeinschaftlichen Bearbeitung elektronischer Dokumente durch die Verfahrensbeteiligten und das Gericht genutzt werden. Das Gericht kann in entsprechender Anwendung des § 1126 Maßnahmen der Prozessleitung ergreifen, um den Streitstoff unter Nutzung der Kommunikationsplattform zu strukturieren.
(2) Die Kommunikationsplattform wird vom Bundesministerium der Justiz als Referenzimplementierung entwickelt und den Ländern zur Anwendung bei den nach § 1123 bestimmten Gerichten bundeseinheitlich bereitgestellt. Die Länder können die Entwicklung und die bundeseinheitliche Bereitstellung der Kommunikationsplattform nach Satz 1 zur Anwendung bei den nach § 1123 bestimmten Gerichten übernehmen; entsprechendes gilt für die Bereitstellung weiterer Anwendungsmodule für die Zwecke nach Absatz 1. Das Bundesministerium der Justiz regelt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die technischen, organisatorischen und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für Entwicklung, Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung der Kommunikationsplattform nach Satz 2 und ihrer Anwendungsmodule.
(3) Die nach Absatz 2 entwickelte Kommunikationsplattform ist über ein Justizportal des Bundes und der Länder für die Nutzer bereitzustellen. Sie ist nach Maßgabe der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung barrierefrei zu gestalten. Ferner ist bei der Gestaltung der Kommunikationsplattform deren Nutzerfreundlichkeit sowie eine einfache und intuitive Bedienbarkeit sicherzustellen.
(4) Die Stelle, die die Kommunikationsplattform nach Absatz 2 bereitstellt, darf personenbezogene Daten nur verarbeiten, soweit dies für die Zwecke nach Absatz 1 erforderlich ist. Die Daten sind spätestens nach rechtskräftigem Abschluss oder nach sonstiger Beendigung des Verfahrens von der Kommunikationsplattform zu löschen. Elektronische Dokumente, Datensätze und sonstige Informationen aus dem über die Kommunikationsplattform geführten Verfahren sind zu den elektronisch geführten Prozessakten nach § 298a zu nehmen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
- Legt die Zwecke fest, wann personenbezogene Daten verarbeitet werden können.
- Schreibt die Löschung personenbezogener Daten vor, was die Privatsphäre der Nutzer schützt und die Speicherung von Daten minimiert.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(5)
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für die Datenübermittlung geltenden Standards und Dateiformate und die Ausgestaltung des Datenschutzes bei Nutzung der Kommunikationsplattform festzulegen.
§ 1131 ZPO Kommunikations-, Austausch- und Übermittlungsformen
(1)
(1) Eine in diesem Gesetz angeordnete Schriftform kann durch unmittelbare Eingabe von Anträgen und Erklärungen der Verfahrensbeteiligten über die Kommunikationsplattform nach § 1130 ersetzt werden, sofern hierfür digitale Eingabesysteme zur Verfügung stehen und eines der folgenden Identifizierungsverfahren genutzt wird:
- für die Identifizierung von Rechtsanwälten: das Verfahren zum Zugang zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach § 31a Absatz 3 Satz 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung;
- für die Identifizierung anderer Verfahrensbeteiligter: ein Verfahren über ein Nutzerkonto nach § 2 Absatz 5 in Verbindung mit § 3 Absatz 4 des Onlinezugangsgesetzes.
Wurde der Nachweis der Identität nach Satz 1 erbracht, so kann die spätere Authentisierung des Inhabers des Identitätsnachweises auch durch andere geeignete Authentisierungsmittel erfolgen.
(2) Eine in diesem Gesetz angeordnete Schriftform kann auch durch Übermittlung elektronischer Dokumente oder strukturierter Datensätze über die Kommunikationsplattform ersetzt werden, sofern
- ein Identifizierungsverfahren nach Absatz 1 genutzt wird,
- bei der Datenübermittlung ein sicheres Verfahren verwendet wird, das die Authentizität und Integrität der Daten gewährleistet, und
- für die elektronischen Dokumente oder strukturierten Datensätze auf der Kommunikationsplattform eine automatisierte Bearbeitung durch das Gericht eröffnet ist.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Stellt die Informationssicherheit sicher, indem sie die Anforderung eines sicheren Verfahrens stellt, das die Authentizität und Integrität der Daten gewährleistet.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(3) Die Gerichte haben bei der digitalen Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten und bei der Bereitstellung von elektronischen Dokumenten zum Abruf ein sicheres Verfahren zu verwenden, das die Authentizität und Integrität der Daten gewährleistet.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Sichere Übermittlungswege und Verfahren gewährleisten, dass die Daten authentisch sind und nicht verändert wurden.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(4) – (5)
(4) Bei der Bereitstellung eines elektronischen Dokuments über die Kommunikationsplattform ist der Empfänger über das von ihm zu diesem Zweck angegebene Postfach oder die von ihm zu diesem Zweck angegebene Adresse spätestens am Tag der Bereitstellung des elektronischen Dokuments darüber zu benachrichtigen, dass dieses abgerufen werden kann. Satz 1 gilt entsprechend für die weitere digitale Kommunikation zwischen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten über die Kommunikationsplattform.
(5) Mit Zustimmung des Empfängers, die für das jeweilige Verfahren erteilt wird und nur mit Wirkung für die Zukunft widerruflich ist, kann abweichend von § 173 Absatz 1 ein elektronisches Dokument auch zugestellt werden, indem es zum Datenabruf über die Kommunikationsplattform bereitgestellt wird. Der Empfänger hat sich beim Datenabruf zu authentisieren. Die Zeitpunkte der Bereitstellung und des Abrufs sind dem Empfänger und dem Gericht automatisiert zu bestätigen. § 173 Absatz 4 Satz 4 und 5 ist entsprechend anzuwenden.
- Fassung vom
- 30. September 2024
- Ressort
- BMJV
SGB VI-Anpassungsgesetz – Einführung Fallmanagement DRV
Alle Beispiele zu dieser Regelung§ 13a SGB VI-AnpG
(1)
(1) Die Träger der Rentenversicherung können Versicherte mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und besonderem Unterstützungsbedarf in Bezug auf die berufliche Teilhabe, die die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach § 11 Absatz 1 oder 2 erfüllen, mit einem Fallmanagement aktivierend und koordinierend bei ihrer beruflichen Wiedereingliederung begleiten und unterstützen.
(2) Zur frühzeitigen Erkennung eines Rehabilitationsbedarfs nach § 13 des Neunten Buches können die Träger der Rentenversicherung bereits vor der Entscheidung über die Durchführung eines Fallmanagements Kontakt mit Versicherten aufnehmen. Das Fallmanagement ist nur mit Einwilligung der Versicherten zulässig. Die Einwilligung ist zu dokumentieren. Für die Durchführung des Fallmanagements erforderliche Datenverarbeitungen dürfen nur mit dem Einverständnis des Versicherten erfolgen.
Warum ist dieses Beispiel gut?
Erforderliche Daten werden nur im Rahmen der DSGVO und mit Zustimmung der Betroffenen verarbeitet.
(Prinzip: Datenschutz und Informationssicherheit schaffen Vertrauen)
(3) – (6)
(3) Das Fallmanagement kann Folgendes umfassen:
- die Erkennung, Ermittlung und Feststellung des individuellen Rehabilitationsbedarfs nach § 13 des Neunten Buches einschließlich der Dokumentation des Bedarfs,
- die Entwicklung und Koordinierung eines individuellen Rehabilitationsprozesses gemeinsam mit den Versicherten und unter Einbindung weiterer Beteiligter sowie die Erstellung eines individuellen Teilhabeplans nach § 19 des Neunten Buches soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen,
- die rechtskreisübergreifende Unterstützung der Versicherten bei der Beantragung von in Betracht kommenden Sozialleistungen und bei der Inanspruchnahme weiterer unterstützender Angebote,
- die Begleitung der Versicherten mit dem Ziel des Erhalts zügiger und aufeinander abgestimmter Leistungen, soweit die Versicherten Ansprüche gegen Träger von Sozialleistungen haben oder haben könnten, die die berufliche Wiedereingliederung fördern und unterstützen können,
- die begleitende Bewertung und mögliche Anpassung des individuellen Rehabilitationsprozesses gemeinsam mit den Versicherten.
(4) Das Fallmanagement kann vollständig oder in Teilen durch die Träger der Rentenversicherung oder durch beauftragte Dritte durchgeführt werden.
(5) Sind bei der Durchführung des Fallmanagements spezifische Anforderungen erforderlich, so können die Träger der Rentenversicherung Dritte damit beauftragen, das Fallmanagement als Leistung durchzuführen. Die spezifischen Anforderungen dieser Leistung bestimmt die Deutsche Rentenversicherung Bund in einem gemeinsamen Rahmenkonzept der Träger der Rentenversicherung.
(6) Führt ein Träger der Rentenversicherung ein Fallmanagement durch, werden die Bedarfsermittlung und, sofern die Voraussetzungen für ein Teilhabeplanverfahren nach Teil 1 Kapitel 2 bis 4 des Neunten Buches vorliegen, das Teilhabeplanverfahren als Bestandteil des Fallmanagements erbracht.
- Ressort
- BMAS